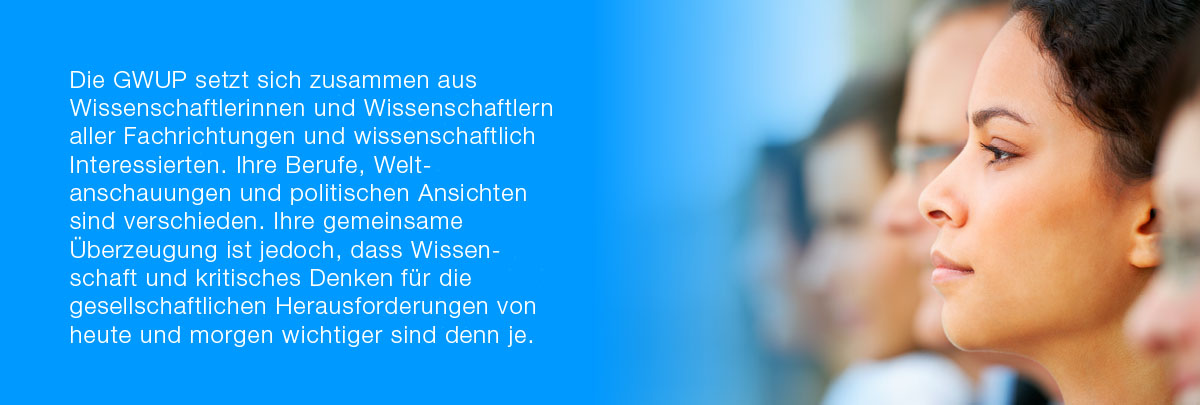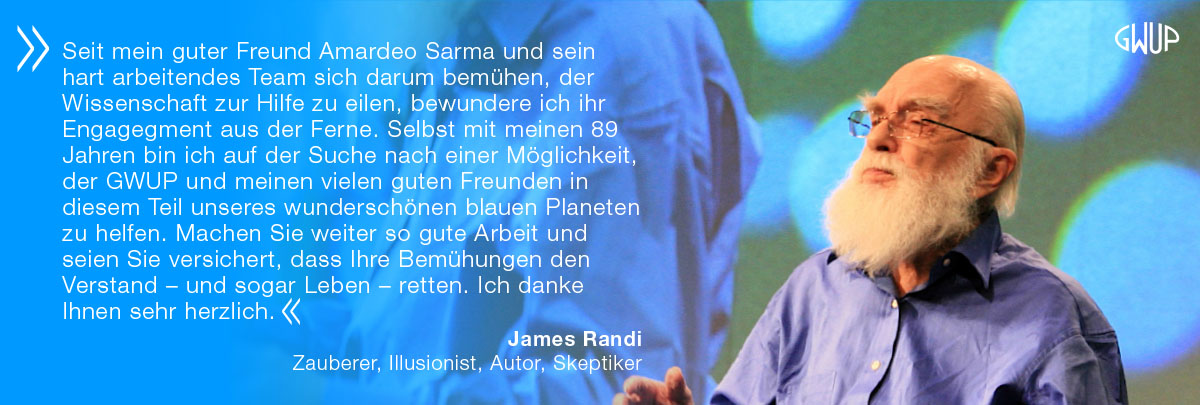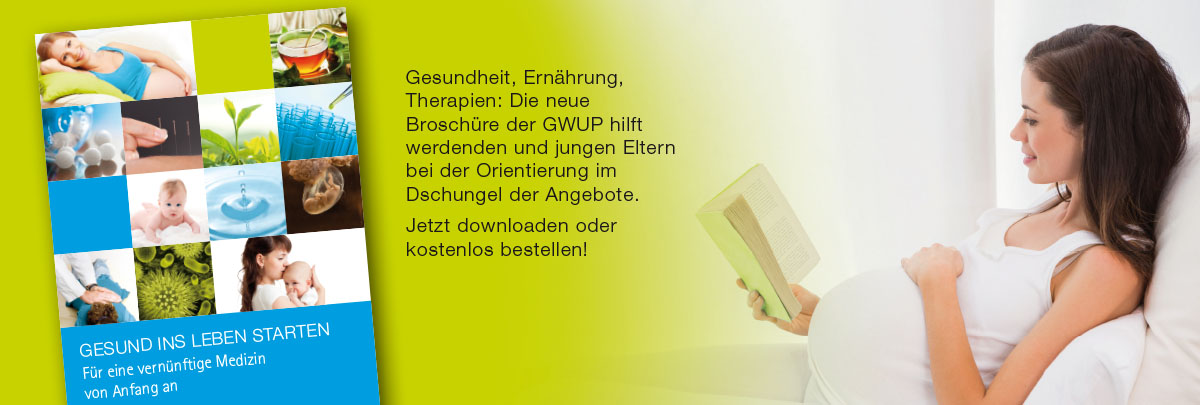Positiv denken gegen Krebs?
Jürgen Windeler
Eine Forschergruppe aus Schottland und Kanada hat sich die Aufgabe gestellt, den momentanen Kenntnisstand zu sichten und hieraus möglicherweise Empfehlungen abzuleiten (British Medical Journal 325, 2002, 1066-1076). Die Autoren fanden auf der Basis einer umfassenden und systematischen Literaturrecherche 26 Studien, die sich mit dem Zusammenhang zwischen psychologischem Umgangsstil und der Überlebenszeit von Krebspatienten, sowie 11 Studien, die sich mit dem Umgangsstil und dem Wiederauftreten eines Tumors („Rezidiv") beschäftigt haben. Die meisten dieser Studien betreffen Frauen mit Brustkrebs, aber auch andere Tumorarten waren vertreten. Nach der beschriebenen Suchstrategie kann davon ausgegangen werden, dass die Autoren keine relevanten Studien übersehen haben.
In einem solchen „systematischen Review" ist zum einen die methodische Qualität der Studien zu beurteilen, zum zweiten die Sinnhaftigkeit und Relevanz der Zielereignisse und zum dritten die untersuchten Einflussfaktoren, hier des Umgangsstils, zu bewerten. Während das zweite Kriterium bei der Analyse von Überleben und Rezidiven kein wesentliches Problem darstellt, wurden bei der methodischen Qualität der Studien erhebliche Mängel festgestellt. Die meisten Studien waren klein, nur 4 der insgesamt 37 Studien umfassten mehr als 200 Patienten. Insbesondere bestand das Problem aber darin, dass störende Einflussgrößen nicht ausreichend berücksichtigt waren; ein Drittel der Studien hatte überhaupt keine Berücksichtigung von Störgrößen vorgesehen.
Aufgeschlüsselt nach Umgangsstil fanden sich folgende Ergebnisse:
- Kampfgeist (fighting spirit): Es fanden sich 10 Studien zum Überleben, von denen nur 3 kleine Studien einen positiven Einfluss beobachten konnten. Zur Rezidivhäufigkeit fanden 3 kleine von insgesamt 4 Studien einen positiven Zusammenhang, die vierte größere Studie jedoch nicht.
- Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit (helplessness, hopelessness): Hierzu wurden 12 Studien zum überleben identifiziert, von denen 2 eine Assoziation fanden. Die 5 Studien zur Rezidivneigung hatten inkonsistente Ergebnisse.
- Verleugnung oder Vermeidung (denial, avoidance), also die Krankheit zu ignorieren oder nicht wahrhaben zu wollen: Von den 10 Studien zur „Verleugnung" fand keine eine signifikante Beziehung zwischen Coping-Stil und Überleben. Die 5 Studien zur Rezidivhäufigkeit lieferten unterschiedliche Ergebnisse, wobei die positiven wiederum klein und von methodisch ungenügender Qualität waren. Das gleiche Bild ergibt sich für die Rezidivneigung, wo eine kleine von insgesamt 8 Studien zu einem positiven Ergebnis kam.
- Stoisches Akzeptieren oder Fatalismus (stoic acceptance, fatalism): Hierzu wurden 9 Studien gefunden; keine der 4 Studien von ausreichender methodischer Qualität fand einen positiven Effekt. Für die Rezidivhäufigkeit ergab sich ein ähnliches Bild.
- Ängstlicher oder depressiver Umgang (anxious coping/anxious preoccupation, depressive coping): Bezüglich des Überlebens wurden 10 Studien gefunden, auch hier waren die Ergebnisse uneinheitlich. Zur Rezidivhäufigkeit gab es keine positiven Ergebnisse.
- Aktiver oder problemorientierter Bewältigungsstil (active or problem focused coping): Hierzu wurden 11 Studien gefunden. Eine kleine Studie zeigte einen positiven Effekt, eine große (mit 850 Patienten) methodisch sorgfältige Studie zeigte keinen Effekt. Bezüglich der Rezidivhäufigkeit konnte kein positiver Effekt gefunden werden.
- Emotionale Faktoren, etwa gefühlsorientierter Umgang oder Unterdrücken von Gefühlen (emotional factors, including suppression of emotions and emotion focused coping): Hierzu wurden 6 Studien zum Überleben gefunden. Die beiden größten und methodisch sorgfältigen Studien ergaben widersprüchliche Ergebnisse.
Die Autoren stellen ergänzend fest, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Berichten von positiven Ergebnissen und der Größe der Studie gibt: Je größer, desto skeptischer. Dies kann üblicherweise (und wohl auch in diesem Fall) als ein Indiz dafür gesehen werden, dass es weitere kleinere Studien mit negativen Ergebnissen gibt, die aber nicht veröffentlicht wurden - also ein so genannter publication bias. In mehreren Leserbriefen äußerten sich u. a. die Autoren einer der größten und methodisch besten der angeführten Studien und erklärten sich mit der Interpretation der Autoren des Reviews nicht einverstanden (siehe Watson et al., Lancet 354, 1999, 1331-1336). Sie machen geltend, dass ihr Studienergebnis valide sei, daher gute Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine hilflose oder ängstlich-depressive Haltung für die Prognose ungünstig ist. Insbesondere ist aber die von diesen Autoren geäußerte generelle Kritik sehr ernst zu nehmen. Es stellt sich nämlich die Frage, wie die Autoren die von ihnen identifizierten Studien dem jeweiligen Umgangsstil zugeordnet haben. Diese Zuordnung ist alles andere als trivial: Sie betrifft sowohl die verwendeten psychometrischen Messinstrumente als auch die Frage, welcher Stil bei den jeweiligen Patienten als dominant angesehen worden ist - schließlich reagieren die meisten Betroffenen auf lebensbedrohliche Krankheiten mit einer Mischung aus verschiedenen „Strategien". Bedauerlicherweise machen die Autoren des Reviews zu diesem Vorgehen keinerlei Angaben. Damit bleibt aber sehr ungewiss, ob in den oben beschriebenen Gruppen wirklich vergleichbare Studien mit vergleichbaren Einflussfaktoren zusammengefasst worden sind oder ob zum Beispiel die unterschiedlichen Ergebnisse innerhalb einer Gruppe auf unterschiedliche Coping-Stile zurückzuführen sind. Dies ist eine relativ gravierende Einschränkung; wie auch immer die Wahrheit aussehen mag, die Studie in ihrer vorgelegten Form offenbart keine überzeugende Argumente für, aber auch zweifellos keine überzeugenden Argumente gegen die prognostische Bedeutung bestimmter Bewältigungsstile. Unabhängig von diesen Einschränkungen sollte allerdings noch einmal deutlich hervorgehoben werden, dass, soweit dies aus dem systematischen Review erkennbar ist, die verschiedenen Studien deskriptiv die Assoziation zwischen dem Umgangsstil der Patienten und der Prognose ihrer Krebserkrankung untersucht haben. Alle diese Studien sagen nichts darüber aus, ob die Art des Umgangs eines Patienten überhaupt erfolgreich verändert werden kann, geschweige denn, ob dies für die Prognose relevant ist. Dies gilt z. B. auch für Ängstlichkeit/Depressivität. Auch wenn es, wie die Autoren der oben angesprochenen Studie schreiben, richtig sein mag, dass dies durch bestimmte psychologische Interventionen gebessert werden könnte, ist damit nicht belegt, dass diese Interventionen auch einen positiven Einfluss auf das Überleben oder die Rezidivhäufigkeit der Patienten haben.
Jürgen Windeler ist Klinischer Epidemiologe und leitet den Fachbereich Evidenz-basierte Medizin beim Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) in Essen.
Dieser Artikel erschien im "Skeptiker", Ausgabe 1/2003.